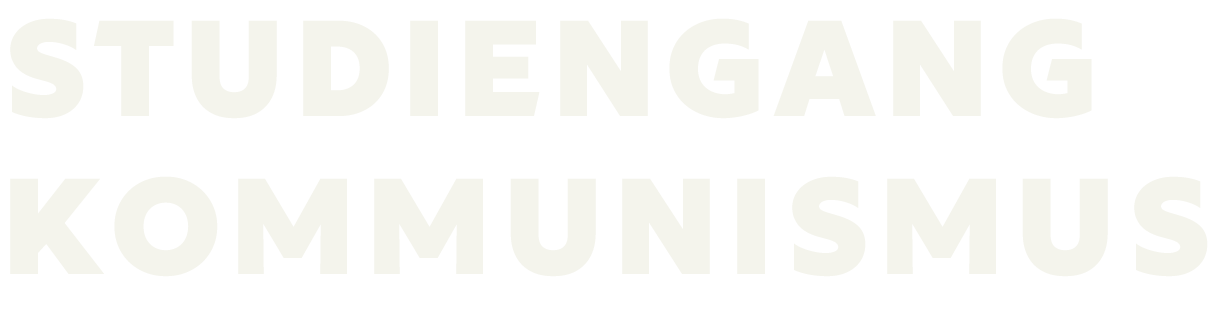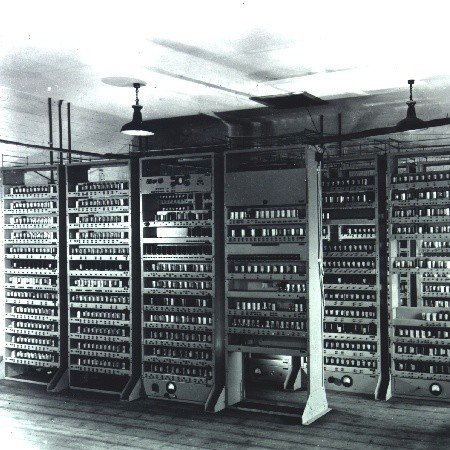
Die Frankfurter Frage und der Maschinen-Mehrwert
Ist nicht doch irgendwo Substanz, ein nachdenkenswerter Ansatz oder ein Körnchen Wahrheit in der „neuen Marxlektüre“ zu finden? Man nehme das Beispiel von der Methusalem-Maschine, die vom Kapitalisten nach Ablauf der erwarteten Lebenszeit längst „abgeschrieben“ ist, aber nicht abtreten will. Schafft da nicht vielleicht doch das konstante Kapital den Mehrwert?
Ein Beitrag von:
D
Ist nicht doch irgendwo Substanz, ein nachdenkenswerter Ansatz oder ein Körnchen Wahrheit in der „neuen Marxlektüre“ zu finden? So wurde aus dem Hessischen erst einmal ganz allgemein nachgehakt, um dem Referenten noch etwas detailliertere Informationen zur Kritik an der Arbeitswerttheorie zu entlocken.
Als das nicht half, kam das Beispiel von der Methusalem-Maschine (MM), die vom Kapitalisten nach Ablauf der erwarteten Lebenszeit längst „abgeschrieben“ ist, aber nicht abtreten will und immer weiter läuft. Schafft da nicht vielleicht doch das konstante Kapital des Kapitalisten den Mehrwert? Der Kapitalist ist hoch erfreut. Bei ihm klingelt die Kasse. Ist das nicht ganz genauso wie bei der Mehrwerterhöhung durch Verlängerung des Arbeitstages?
Bei diesem Beispiel stockte der Referent und auch wir verhakten uns im selbstgestrickten Knoten, der auf die Schnelle nicht entwirrt werden konnte.
Grund dafür war vielleicht das nicht unbedingt marxistische Wort von der „Abschreibung“, mit dem die Wertübertragung des konstanten Kapitals auf die vom Kapitalisten unter Einsatz von c + v neugeschaffene Ware unglücklich beschrieben wird. Klar, dass damit keine steuerliche Abschreibung gemeint war. Aber der Begriff „Abschreibung“ lässt doch eher an die Kostenkalkulation des einzelnen Kapitalisten denken. Dass aber nicht die Kosten (=Kostpreis), also die vom einzelnen Kapitalisten vor dem wertschaffenden Arbeitsprozess aufgewandte Kapitalmenge (c + v), sondern allein die zur Warenproduktion gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit den Wert bestimmt, behandelt Marx grundlegend im ersten, dann speziell eingehend auf Verschleiß und Reparatur im zweiten (MEW 24, 169f.) und noch einmal ausführlich im dritten Band des Kapitals, dort mit Erklärung der gängigen Fehlvorstellungen der bürgerlichen Ökonomie und der Warnung, dass der Kostpreis des einzelnen Kapitalisten zwar regelmäßig unter dem Wert seiner Ware liegt, aber es sich doch letztlich um zwei Paar Schuhe handelt, die oft verwechselt werden, jedoch nicht verwechselt werden sollten.
Der in der Ware des Kapitalisten A steckende Wert setzt sich zusammen allein aus der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit, die
- in dem zu ihrem tatsächlichen Wert (also mit Einschluss der unbezahlten Mehrarbeit) unter Einsatz des konstanten Kapitals von einem anderen Kapitalisten B erworbenen Produktionsmittel enthalten ist und „pro rata“ nach dem gesellschaftlichen Durchschnitt ihrer Lebenserwartung ohne neue Wertbildung im Arbeitsprozess nur übertragen wird und
- bei der Herstellung in der Fabrik des Kapitalisten A unter Einsatz des variablen Kapitals als Arbeitslohn wertbildend (inkl. Mehrwert) in das Produkt gesteckt wird.
Marx spricht bei dem Wertbestandteil zu 1. stets nur von Wertübertragung des konstanten Kapitals, die bei Rohmaterial (z.B. Garn) im Ganzen und bei Produktionsmitteln (z.B. Strickmaschine) anteilig („pro rata“) auf die neu geschaffene Ware erfolgt. Diese dient als „Arbeitsaufsauger“ (MEW 23, 204). Die Wertübertragung ist nur „Bedingung“ des Arbeitsprozesses nicht jedoch Teil der Wertbildung (MEW 23, 196), in meinem Beispiel beim nachfolgenden Kapitalisten A. Der mit dem konstanten Kapital beim Kapitalisten B erworbene Wert wird im Betrieb des Kapitalisten A der dort hergestellten Ware nur „zugesetzt“ (deshalb konstant), nicht aber neuer Wert geschaffen.
Also bestimmen die Kosten für den Kauf der MM (=Produktionsmittel) genauso wenig wie die Kosten (Arbeitslohn) für den Kauf der Ware Arbeitskraft den Wert der in der Fabrik des Kapitalisten A gefertigten Ware, sondern allein die Quantität der zu ihrer Produktion im Durchschnitt gesellschaftlich notwendigen allgemein menschliche Arbeit.
Die Lebenszeit der MM spielt keine Rolle. Sie wirkt nicht wertbildend. Ebenso wenig kann normalerweise der unglückliche Konkurrent C, dessen gleichartige Maschine durch Brand, Überschwemmung, einen strengen Winter oder Schlendrian vorzeitig ihre Dienste eingestellt hat, als Kompensation seines Missgeschicks am Markt einen Aufschlag für verfrühte Ersatzbeschaffung durchsetzen. Bei der Wertbildung zählt allein die im Durchschnitt gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit zur Herstellung der Ware. In diesem Durchschnitt finden zwar auch Reparaturfälle und Verluste durch Havarien usw. (normalerweise geringfügig) Berücksichtigung. Allerdings nur in dem Maß der Häufigkeit solcher Havarien im Durchschnitt aller Produktíonsmittel gleicher Art, so dass der Verlust durch die individuelle Erhöhung des Kostpreises beim Unglücksraben C (soweit keine Versicherung einspringt) dadurch nicht kompensiert wird:
„Bei der Bestimmung des Verschleißes, wie der Reparatur kosten, nach gesellschaftlichem Durchschnitt, ergeben sich notwendig große Ungleichheiten, selbst für gleich große und sonst unter denselben Umständen befindliche Kapitalanlagen in demselben Produktionszweig. In der Praxis dauert für den einen Kapitalisten die Maschine etc. über die Durchschnittsperiode hinaus, bei dem andern nicht so lange. Die Reparaturkosten des einen sind über, die des andren unter dem Durchschnitt usw. Der durch den Verschleiß, wie durch die Reparatur kosten, bestimmte Preiszuschlag der Ware ist aber derselbe und wird durch den Durchschnitt bestimmt. Der eine erhält also durch diesen Preiszusatz mehr, als er wirklich zusetzt, der andre weniger. Dies, wie alle andren Umstände, die bei gleicher Exploitation der Arbeitskraft den Gewinn verschiedner Kapitalisten in demselben Geschäftszweig verschieden machen, trägt dazu bei, die Einsicht in die wahre Natur des Mehrwerts zu erschweren“
(Kapital Bd. 2, MEW 24, S. 178)
Die Summe der im Beispiel übertragenen Anteile am Wert der MM ist nach oben nicht durch „Abschreibung“ (= Kostpreis des A für diese eine Maschine), sondern in Wahrheit nur durch die Summe des Wertes aller gleichartigen Maschinen (mit unterschiedlicher Lebenserwartung) begrenzt. Der Kostpreis des A ist vielleicht längst durch Verkauf seiner Waren als Revenue in seine Kasse zurückgeflossen. Dennoch ist der Extraprofit, der dort klingelt, nicht durch wertbildende „Arbeit“
seiner MM entstanden, sondern in der Zirkulation durch Verkauf seiner Ware zu ihrem regulären Wert (gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit zur Herstellung) realisiert worden. Die überlange Lebenszeit der MM erlaubt A lediglich, einen Teil des Wertes der Gesamtheit aller Produktionsmittel gleicher Art in die bei ihm produzierten Waren zu stecken und nach Durchlaufen der Zirkulationssphäre in Geldform als Revenue in seine Kasse zu leiten. Dem Pechvogel C fehlt durch das vorzeitige Ableben seiner Maschine hingegen der Teil seines konstanten Kapitals, der für den Ankauf der gleichartigen Maschine verausgabt wurde, aber durch ihr vorzeitiges Ableben nicht mehr „pro rata“ in die bei C produzierten Waren übertragen und gedeckt werden konnte. Insofern hat A den C und alle Konkurrenten expropriiert, deren gleichartige Maschinen vor der durchschnittlichen Zeit ihr Leben aushauchen.
Titelbild: Foto der Electronic Delay Storage Automatic Calculator im Mathematischen Labor der Universität Cambridge, England, 1948, CC BY 2.0, https://w.wiki/FTMf