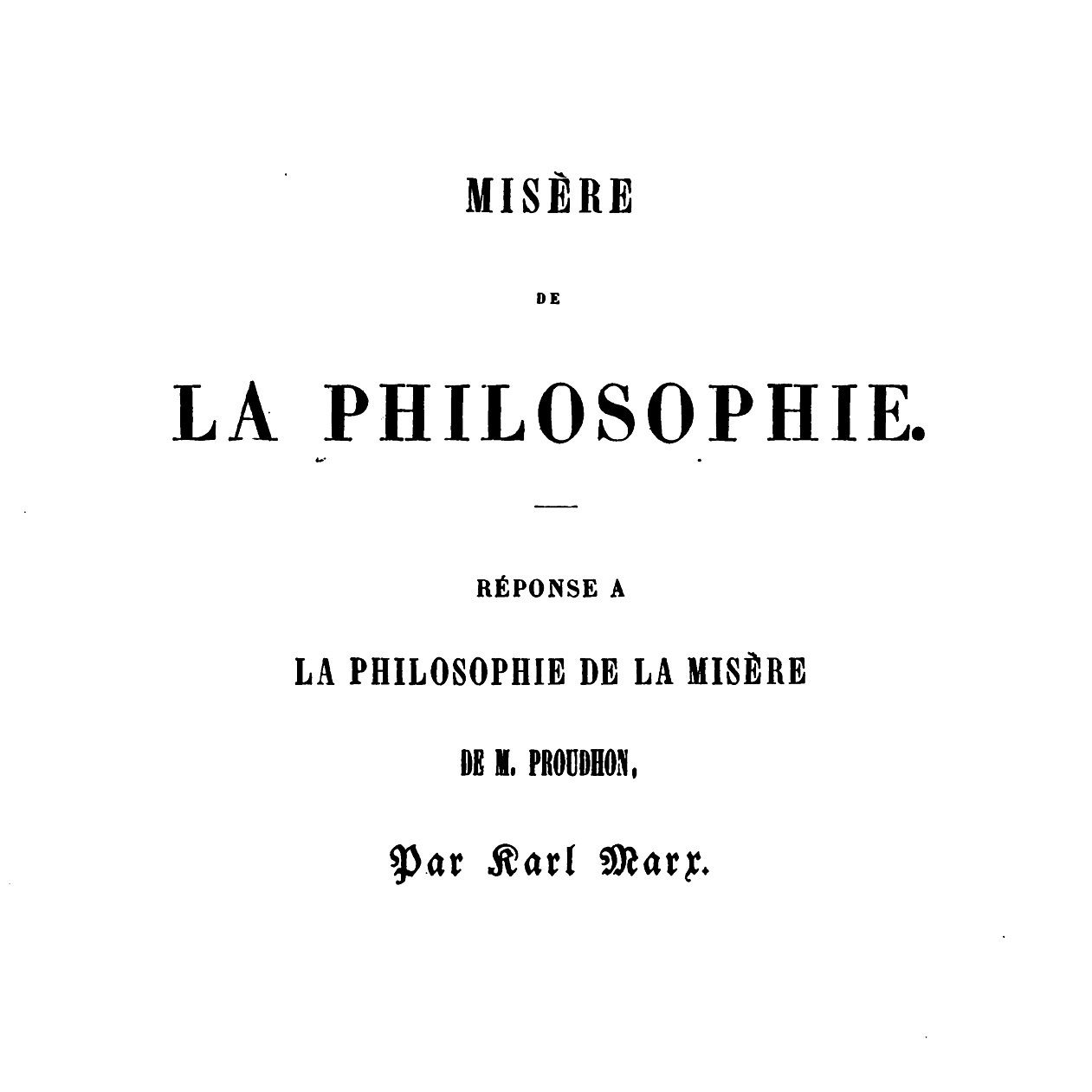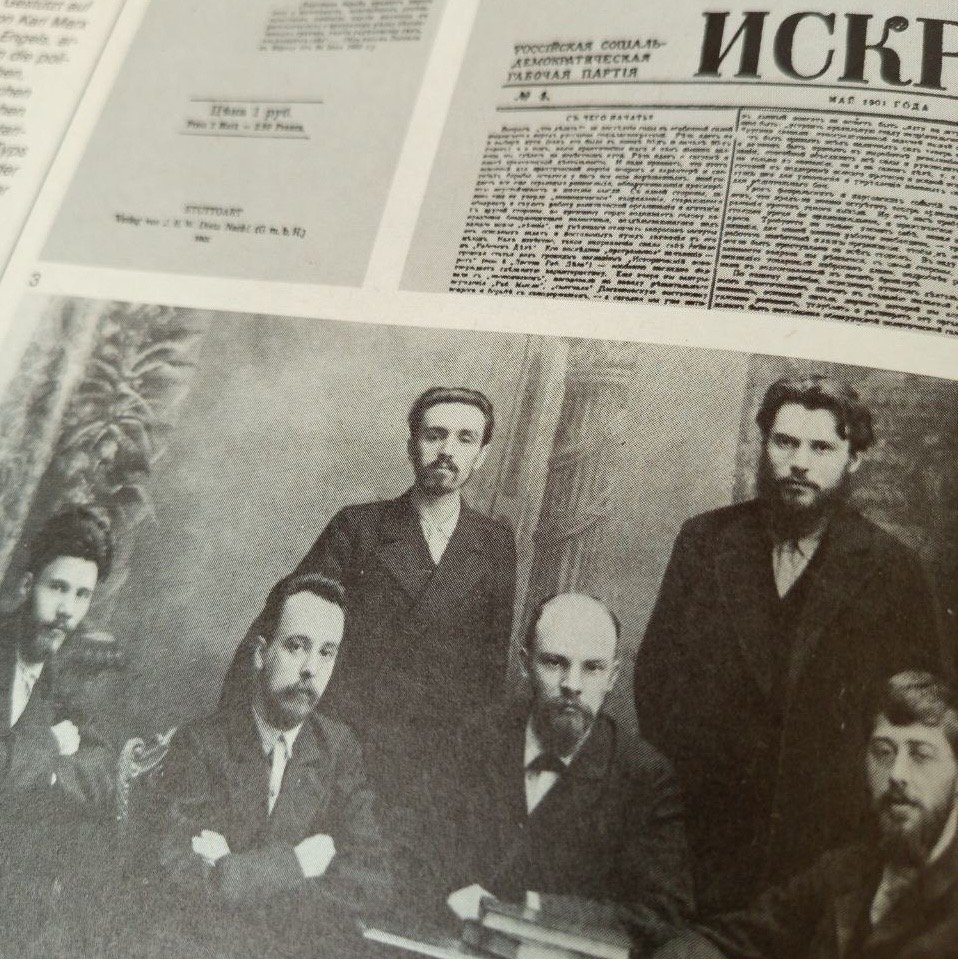In diesem Kommentar möchte ich kurz in eine Problemstellung einleiten, die unter anderem innerhalb des Lesezirkels in Leipzig angeschnitten wurde. Vorab sei erwähnt, dass es sich hier keinesfalls um eine ausführliche Darstellung oder gar Analyse dieser Problematik handelt, sondern lediglich ein paar Schlaglichter auf die m.E. relevanten Punkte dieser Frage- und Problemstellung geworfen werden.
Es geht um die Frage nach dem „Ende“ aller „seitheriger“ Philosophie, wie es im gängigen Verständnis sinngemäß u.a. aus der deutschen Ideologie, der Feuerbachthese oder der Einleitung zur Kritik der hegelschen Rechtsphilosophie entnommen wird. Hierbei geht es Marx selbstverständlich nicht um eine Verneinung der Philosophie als Ganzes oder des philosophischen Denkens bis dato, sondern vielmehr will er darauf hinaus, dass es um eine bestimmte Rolle und einen Zweck der Philosophie geht. Zusammenfassend lässt es sich mit der elften Feuerbachthese relativ sinnvoll bestimmen. Marx meint hier: „Die Philosophenhaben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern.“ Quelle: Thesen überFeuerbach – MEW Band 3, S. 7
Es kam daraufhin zur Frage, ob es denn demnach auch eine explizit marxsche Methodik gäbe und ob Marx unter anderem aufbauend auf der elften Feuerbachthese, eine eigene Methode bzw. Methodik entwickelt hätte, bzw. Ansätze zu finden sind, wo man dies erkennen könne. Ausgangspunkt dieser Überlegung innerhalb des Lesezirkels war die entscheidende Pointe, die mit dem oben genannten Zitat deutlich wird: Philosophie muss als etwas Praxisbezogenes verstanden werden. Als Werkzeug für den Klassenkampf, wenn man so will.
Was hierbei ebenfalls sehr deutlich wird, ist die Frage nach der Philosophie selbst. Also durch was und wie begründet sie sich eigentlich? Was und warum nennt man „Philosophie“ oder das „Philosophieren“. Es wird sehr schnell klar, dass es hier keine absolute und fixe Antwort gibt. Marx selbst hat sich dieser Fragestellung sehr arbeitsintensiv und systematisch angenähert, um nicht zu sagen: er hat aller seitherige Philosophie im Prozess der Auseinandersetzung mit der Philosophie als Philosophie aufgehoben. Das Prinzip der Aufhebung und Verwirklichung der Philosophie spielt bei den philosophischen Frühschriften von Marx eine m.E. explizit und implizit zentrale Rolle. Ein schönes Beispiel dafür ist diese Formulierung aus der Einleitung zur Kritik der hegelschen Rechtsphilosophie. Hier heißt es: „Der Kopf dieser Emanzipation ist die Philosophie,ihr Herz das Proletariat. Die Philosophie kann sich nicht verwirklichen ohne die Aufhebung desProletariats, das Proletariat kann sich nicht aufheben ohne die Verwirklichung der Philosophie.“ Quelle: ZurKritik der hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung – MEW Band 1, S. 391
An dieser Stelle wird meiner Meinung nach schon sehr sichtbar, wie wichtig Marx die Bestimmung der Philosophie gewesen ist und wie er den Zusammenhang und damit auch die Widersprüchlichkeit der Philosophie zwischen Proletariat und Philosophie be- und anmerkte. Allgemeines Ziel unserer heutigen Beschäftigung mit der Frage rund um die dialektische Philosophie muss es sein, eine Form der Begründung darum zu entwickeln und herauszuarbeiten, wie und an welchen Stellen sich die dialektische Philosophie gesellschaftlich materialisiert, also faktisch politisch werden lässt.
Marx war Schüler und Kritiker der klassisch bürgerlichen Philosophie, bzw. des deutschen Idealismus. Seine Bezugnahme auf ganz bestimmte Grundlagen und Erkenntnisse dieser Denkschule, ist bis heute relevant für unser Verständnis der marxistischen Philosophie. Ich denke, dass auf diesem Gebiet noch einiges an Reflexionsleistung erbracht werden muss, um besser zu verstehen, wie wir das Wesentliche der Methodik bei Marx und die Methodik als Wesentliches in der Philosophie selbst verstehen und bestimmen müssen. Der geschichtsphilosophische Zugang zu dieser Frage ist hierbei für mich entscheidend, denn nur im Verständnis einer bestimmten Entwicklung, also im Prozess, man könnte auch sagen: im Werden begriffen, wird es möglich sein, die Quellen und Bestandteile unserer Philosophie zu verstehen.
Darin liegt meiner Meinung nach auch die Antwort auf die oben angedeutete Frage des Lesezirkels der eigenen Methode bei Marx oder beim Marxismus. Kern seiner Überlegung war es, die bis- oder seitherige Philosophie in ein Verhältnis zur Realentwicklung der materiellen Basis, bzw. dem revolutionären Subjekt der jeweiligen Epoche zu setzen und zu schauen, wie und ob sich daraus progressive Praxis entwickelt hat. Diese Parteilichkeit der Philosophie ist nichts rein Gedachtes, sondern etwas aus den Verhältnissen selbst Hervorgehendes, etwas notwendig Werdendes, d.h. im Klassenkampf Entwickeltes.
Innerhalb dieses Versuchs bzw. im Herangehen an die Frage und die Philosophie zu Marxens Zeiten selbst und dem nicht abgeschlossenen, sondern lediglich aufgeworfenen und begonnenen Prozess des Aufhebens und Verwirklichens der Philosophie, liegt ebenso der Charakter der marxschen Philosophie, weil sie ein fundamental anderes Bild auf Geschichte, Gesellschaft und Methodik möglich und greifbar macht. Es ist sozusagen ein umgestülptes Verhältnis in Form eines Perspektivwechsels vom handelnden Subjekt zumObjekt möglich, das es erlaubt, nicht nur mehr zuzuschauen, sondern einzugreifen, weil das eigene Sein begründet ist im Werden und die Philosophie ab diesem Punkt keine Einzeldisziplin mehr sein kann, die sich hauptsächlich mit sich selbst beschäftigt, wie man das beispielsweise aus Strömungen der bürgerlichen Philosophie kennt, die in letzter Instanz immer die bestehenden Verhältnisse legitimieren oder „neu“ erfinden sollen.
Zum Schluss möchte ich nochmal betonen, wie relevant die Beschäftigung mit der Rolle und dem Zweck derPhilosophie für uns als Kommunisten ist. Es geht darum, die Philosophie als etwas parteilich politisches zuverteidigen und den Moment des Aufhebens und Verwirklichens der Philosophie in den Vordergrund zurücken. Es ist deshalb von Relevanz, unsere weltanschauliche Grundlage des dialektischen Materialismusund die darin zur Geltung kommende materialistische Dialektik als Methode, vor den Vorstellungen einervon den Fragen unserer Zeit losgelösten Einzeldisziplin zu schützen, d.h. den Charakter der Philosophie im marxschen Sinne zu schützen. Dies gelingt nur dann, wenn wir die Philosophie als wesentlichen Bestandteil einer kommunistischen Organisation oder Partei verstehen und sie sich in den konkreten Erfahrungen und theoretischen Diskussionen entfalten kann, die zugeschnitten sind auf programmatische Schritte der Organisation selbst.
Titelbild: Cover der 1. Auflage des Elend der Philosophie von Karl Marx, veröffentlicht auf Französisch im Jahr 1847, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mis%C3%A8re_de_la_philosophie.jpg (zuletzt aufgerufen am 16.11.2025)